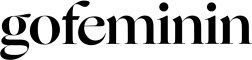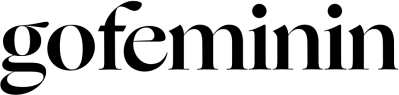Liebe oder nicht?
Jeder Mensch hat nun mal eigene Vorstellungen von einer Beziehung, der eine braucht viel Freiraum, der andere weniger.
Ihr habt mit einer Wochenendbeziehung begonnen und vielleicht ist das auch exakt das gewesen, was Dein Freund wollte, nicht mehr, nicht weniger. Nun erwartest Du auf einmal mehr, willst dauernd anrufen, drängst auf Aufmerksamkeiten (Valentinsgeschenk), versuchst ihn unter der Woche zu besuchen.
Gut möglich, daß er das nicht will, weil für ihn einfach alles zu seiner Zeit drankommen sollte: Werktags der Job, werkabends Freunde und Hobbies, am Wochenende die Partnerin.
Das ist sein gutes Recht, deshalb solltest Du ihm sein Verhalten nicht vorwerfen, schon gar nicht mit "Lieblosigkeit" gleichsetzen. Er ist eben einfach nur spröder als Du.
Die Frage ist, welche Vorstellungen Du von Eurem Ding hast, vor allem in Hinblick auf die Zukunft. Würdest Du Dich dauerhaft mit einer Wochenendbeziehung zufriedengeben, oder erhoffst Du tief innen drin mehr, sprich: Zusammenziehen und Familiengründung als von beiden Seiten gewünschte potentielle Option für die Zukunft?
Wenn ja, dann rede nächstes Wochenende mal mit ihm, aber bitte nicht im Ton der beleidigten Leberwurst, sondern sachlich und vor allem mit klar formulierter Zielsetzung. Sag ihm klipp und klar, mit welchen konkreten Erwartungen Du an die Beziehung rangegangen bist und dann frag ihn, ob er diese Erwartungen teilt. Offenbar tut er das in einigen Punkten nicht. Dann rede nicht soviel von Dir und wie wenig Dir das gefällt, sondern bohr weiter, aber frag ihn, wie er sich Eure Beziehung vorstellt. Was denkt er, wo Ihr in 3, 5, 10 Jahren stehen werdet, welche Vision hat er für sich und Dich im Hinterkopf?
Oder hat er evt. gar keine, ist er jemand, der nur in den Tag hineinlebt?
Auch das ist möglich.
Eventuell werdet Ihr feststellen, daß Eure Vorstellungen nicht passen. Dann fragt Euch, inwiefern es noch Sinn macht, Euer Ding fortzusetzen, bzw. ob Ihr es nicht lieber unter geänderten Vorzeichen fortsetzen wollt: Nämlich daß Du Deine Erwartungen runterschraubst und es mehr als vorübergehende Lebensetappe siehst, denn als große Liebe Deines Lebens.
Solltest Du mit dieser Vorstellung nicht klarkommen, dann werde Dir dessen bewußt und zieh die Konsequenzen. Mach nur einen Fehler bitte nicht: Nach "Schuld" suchen. Die trifft weder ihn, noch Dich.
Ihr habt Euch unter bestimmten Voraussetzungen kennengelernt, aufeinander eingelassen, die Sache laufen lassen, jetzt zeigt sich, daß es vielleicht doch nicht so passt wie Ihr Euch das dachtet und entweder Ihr könnt Euch zusammenraufen, oder nicht.
Ich wünsch Euch viel Glück dabei,
L.