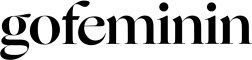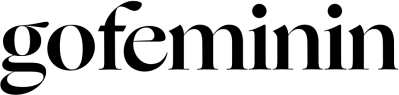Warum hast Du Deiner Tochter nich beigebracht....
... wie man Daten vernünftig verschlüsselt?
OK, blasen ist natürlch einfacher ;-)
Hhaydn_12699662
- 22. März 2013
- Beitritt 15. Okt 2011
- 0 Diskussionen
- 19 Beiträge
- 0 beste Antworten
Das stimmt!
Qualitativ & Quantitativ.
Konnte ich mir auch nicht vorstellen, als ich jünger war. Ist aber so... so, mal ein wenig juristischer Hintergrund
Recherche über Bewerberinnen und Bewerber in sozialen Netzwerken sowie Internet-Suchmaschinen durch Arbeitgeber
1. Sachverhalt
Ende August 2009 ist in den Medien über eine Studie im Auftrag der Bundesregierung berichtet worden, wonach circa 30 Prozent der Arbeitgeber über Bewerberinnen und Bewerber in sozialen Netzwerken sowie Internet-Suchmaschinen recherchieren und die erhobenen Daten bei der Entscheidung über eine Stellenbesetzung verwenden würden 1. In sozialen Netzwerken tauschen Betroffene eine Vielzahl privater Daten aus, nutzen die Netzwerke als Kontaktbörsen und so weiter.
1 www.berlinonline.de; www.welt.de; www.abendzeitung.de; www.fr-online.de und andere
2. Rechtsgrundlagen zur Datenerhebung über Bewerberinnen und Bewerber
Diese Recherchen stellen eine Datenerhebung dar, deren Zulässigkeit sich nach 32 Absatz 1 Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz richtet, wonach personenbezogene Daten eines Beschäftigten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben werden dürfen, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist.
3. Erforderlichkeit der Daten über Bewerberinnen und Bewerber
Regelmäßig ist die Erhebung und Speicherung von Bewerberdaten nur zulässig, soweit sie für den konkret zu besetzenden Arbeitsplatz erforderlich sind. Allgemein anerkannt ist, dass das Fragerecht und Ermittlungsrecht des Arbeitgebers im Interesse des Persönlichkeitsschutzes des Beschäftigten der Einschränkung bedarf.
Das Bundesarbeitsgericht hat in ständiger Rechtsprechung eine Beschränkung des Fragerechts aus dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Bewerberin oder des Bewerbers abgeleitet. Bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Erhebung von Bewerberdaten beziehungsweise Beschäftigtendaten müsse das Interesse der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers an der ungestörten Privatsphäre mit dem Interesse des Arbeitgebers, sich Aufklärung über den Arbeitnehmer zu verschaffen, abgewogen werden. Hieraus folge, dass nur solche Fragen gestellt werden dürften, die mit dem Arbeitsplatz oder der zu leistenden Arbeit im Zusammenhang stünden2.
2 Bundesarbeitsgericht vom 22. September 1961, Arbeitsrechtliche Praxis Nummer 15
In zahlreichen Einzelfällen war die Rechtsprechung mit der Frage der Zulässigkeit der vom Arbeitgeber gestellten Fragen befasst, zum Beispiel zur Frage der beim früheren Arbeitgeber bezogenen Vergütung 3 und zur Frage nach einschlägigen Vorstrafen 4.
3 Bundesarbeitsgericht vom 19. Mai 1983, Der Betrieb 1984, Seite 298
4 Bundesarbeitsgericht vom 05. Dezember 1957, Arbeitsrechtliche Praxis Nummer 2 und Bundesarbeitsgericht vom 15. Januar 1970, Arbeitsrechtliche Praxis Nummer 7
Soziale Netzwerke und Internet-Suchmaschinen enthalten personenbezogene Daten, die mehr oder weniger die Privatsphäre der Betroffenen tangieren; jedenfalls sind sie regelmäßig nicht beziehungsweise nicht eindeutig getrennt von Daten, die im Rahmen von Bewerbungsverfahren für konkrete Arbeitsplätze relevant sein könnten.
Insoweit erhalten Arbeitgeber bei der Recherche über Bewerberinnen und Bewerber im Internet - beabsichtigt oder unbeabsichtigt, jedenfalls unvermeidbar - eine Vielzahl von Daten über die Betroffenen, obwohl sie für den zu besetzenden Arbeitsplatz nicht erforderlich ist.
Daher hätten nach der Studie offensichtlich viele Arbeitgeber weiterhin triftige Gründe gegen die Bewerber-Recherche im Internet, unter anderem weil es zu aufwendig sei oder weil Bedenken hinsichtlich der Qualität der erlangten Informationen bestünden. Insbesondere sei nicht sichergestellt, woher diese Informationen kämen und wie zuverlässig sie seien. Zudem verzichtetet circa ein Drittel der Befragten auf Online-Recherchen, um die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu achten.
Nach diesen Ausführungen bestehen erhebliche Zweifel an der Erforderlichkeit derartiger Recherchen, da dadurch viele Informationen über Bewerberinnen und Bewerber im Internet durch Arbeitgeber erhoben werden, die nicht in einem Zusammenhang mit der Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses stehen.
Außerdem handelt es sich um Informationsquellen, die keine zuverlässigen Auskünfte über Bewerberinnen und Bewerber geben können und demzufolge nicht geeignet sind, notwendige Informationen über Bewerberinnen und Bewerber zu erhalten. In Internet-Suchmaschinen kann über die Eingabe des Namens eine Vielzahl personenbezogener Daten über die Person abgerufen werden.
In diesen Systemen kann von den Arbeitgebern weder unterschieden noch festgestellt werden, ob die Daten von den Betroffenen selbst oder von Dritten über sie ohne ihre Kenntnis eingegeben wurden oder ob sie richtig sind. Nach der Studie suchen Arbeitgeber im Internet systematisch auch nach Hobbys, Interessen, Meinungsäußerungen, privaten Vorlieben und so weiter.
Demzufolge ist die Internet-Recherche über Bewerberinnen und Bewerber durch Arbeitgeber auch nicht geeignet, zuverlässige und ausschließlich erforderliche Angaben über Bewerberinnen und Bewerber bezogen auf den jeweils zu besetzenden Arbeitsplatz zu erhalten.
4. Grundsatz der Direkterhebung bei Bewerberinnen und Bewerbern
Die hier in Rede stehende Datenerhebung entspricht nicht dem Grundsatz der Direkterhebung, weil die Daten aus anderen Quellen und bei Dritten erhoben werden. Zur konkreten Ausgestaltung beziehungsweise Begrenzung der Datenerhebung für Arbeitgeber gilt der Grundsatz der Direkterhebung, und zwar nach 4 Absatz 2 Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz.
Ausnahmsweise ist eine Datenerhebung bei Dritten nach 4 Absatz 2 Satz 2 Bundesdatenschutzgesetz zulässig. Hier bedarf es jedoch einer Abwägung der Erforderlichkeit hinsichtlich des zu erfüllenden Geschäftszwecks und der schutzwürdigen Interessen des Betroffenen.
Unter Hinweis auf die Anmerkungen unter Nummer 3 liegen diese Voraussetzungen für diese Art der Datenerhebung schon deshalb nicht vor, weil sie für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses nicht geeignet ist.
Insbesondere die Internet-Recherche bietet nicht die gebotene Zuverlässigkeit, die gerade im Bewerbungsverfahren von besonderer Bedeutung ist und weil hierdurch zwangsläufig die Erhebung einer Vielzahl privater und zudem mehr oder weniger nicht richtiger Daten sowie nicht erforderlicher Daten über Bewerberinnen und Bewerber erhoben werden.
5. Ausnahme vom Grundsatz der Direkterhebung
Der Arbeitgeber kann jedoch in dem Fall berechtigt sein, eine Internet-Recherche über eine Bewerberin und einen Bewerber vorzunehmen, wenn diese von sich aus ohne direkte oder indirekte Aufforderung durch den Arbeitgeber auf bestimmte oder unbestimmte Internet-Adressen hinweist und ihm insoweit eine den Anforderungen des 4 a Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz entsprechende Einwilligung erteilt, Daten über sie bei genannten oder nicht genannten Dritten zu erheben.
Hierbei dürfte jedoch beachtlich sein, dass Betroffene Internet-Auftritte speziell für Arbeitgeber erstellen können und insoweit Zweifel bestehen, ob dadurch für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderliche Daten vorliegen, die nicht bereits in den regulären Bewerbungsunterlagen enthalten sind beziehungsweise in Vorstellungsgesprächen erhoben werden.
6. Schutzwürdige Interessen der Betroffenen
Durch die Internet-Recherche und unter Hinweis auf die unter Nummer 3 dargestellte Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts wird die Privatsphäre von Bewerberinnen und Bewerbern unzumutbar gestört. Dies wird nachfolgend verdeutlicht:
Gerade in der jüngeren Generation hat sich eine neue Kultur der Online-Kommunikation entwickelt, die durch die Möglichkeiten des Internets entscheidend geprägt werden. So gibt es Aussagen von Schülerinnen und Schülern oder Studentinnen und Studenten, wonach die Teilnahme an Facebook, SchülerVZ oder StudiVZ zu den praktisch unverzichtbaren Bedingungen gehört, innerhalb dieser Personengruppe Kontakte zu suchen oder anerkannt zu werden.
Darüber hinaus gibt das Web 2.0 vielen Gleichgesinnten, sei es wegen gleicher Erkrankungen oder persönlicher Vorlieben, politischer, religiöser oder ethnischer Zugehörigkeit Plattformen, die für die Betroffenen häufig als unverzichtbar für ihre Teilhabe an und in der Gesellschaft oder auch zur Wahrung ihrer Rechte in vielfältigen Lebenssituationen angesehen werden. Auch die Faszination oder vielfach auch Sucht erzeugende Nutzung des Internets dürften hier eine nicht unbedeutende Rolle spielen.
Außerdem können Arbeitgeber dadurch Daten erheben, deren Kenntnisnahme ein Einfallstor für unzulässige Benachteiligungen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz wäre, wie zum Beispiel Daten über die Rasse oder ethnische Herkunft, Religion oder Weltanschauung, eine Behinderung oder die sexuelle Identität.
Zudem ist es für eine Einzelperson nicht mehr möglich selbst zu entscheiden, ob und welche personenbezogenen Daten über sie im Internet veröffentlicht werden. Jede geschäftsfähige Person kann zwar über Art und Umfang ihrer von ihr selbst im Internet preisgegebenen Daten entscheiden; gleichwohl hat sie regelmäßig keine Übersicht oder Kontrolle mehr darüber, wann darüber hinaus wer welche Daten über sie, an welchem Ort, in welchem Kontext und auf welcher Homepage ins Internet gestellt hat.
Diese Beispiele belegen eindeutig, dass das Internet und insbesondere Web 2.0 erhebliche Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen aufweisen. Nicht ohne Grund bemühen sich die Datenschutzbeauftragten und Aufsichtsbehörden für den Datenschutz des Bundes und der Länder, die Landesmedienanstalten und andere Bildungseinrichtungen, die Medienkompetenz und Datenschutzkompetenz von Personen und insbesondere von Schülerinnen und Schülern zu verbessern.
Darüber hinaus ist bisher nicht bekannt, ob Arbeitgeber Bewerberinnen und Bewerbern über Internet-Recherchen nach 33 Bundesdatenschutzgesetz benachrichtigen, geschweige denn, die Ablehnung mit Informationen aus dem Internet insbesondere aus sozialen Netzwerken begründen. Im Gegenteil: Häufig geben sich Arbeitgeber bewusst eine falsche Identität, um in nur für bestimmte Personengruppen jedoch nicht für Arbeitgeber vorgesehenen sozialen Netzen unentdeckt Daten über Bewerberinnen und Bewerber auszuforschen. Insoweit findet die Datenerhebung sogar bewusst heimlich statt.
Dadurch verletzten Arbeitgeber-Recherchen über Bewerberinnen und Bewerber im Internet deren schutzwürdige Interessen erheblich, da als Folge die Nichtteilnahme am Arbeitsleben drohen kann, zumal ein Arbeitsplatz zu den existenziellen Lebensgrundlagen in unserer Gesellschaft zählt.
Schutzwürdige Interessen der Bewerberinnen und Bewerber werden zudem durch den Verstoß gegen den Grundsatz der Direkterhebung sowie die unterbliebene Unterrichtung beziehungsweise Benachrichtigung der Bewerberinnen und Bewerber ebenfalls erheblich beeinträchtigt.
7. Öffentlichkeit der Daten in Internet-Suchmaschinen und sozialen Netzwerken
Nach 28 Absatz 1 Nummer 3 Bundesdatenschutzgesetz dürfen allgemein zugängliche Daten erhoben werden, soweit schutzwürdige Interessen des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung gegenüber den berechtigten Interessen der verantwortlichen Stelle offensichtlich überwiegen.
Unabhängig davon, dass 28 Absatz 1 Nummer 3 Bundesdatenschutzgesetz nach der Schaffung des bereichsspezifischen 32 Bundesdatenschutzgesetz nicht anwendbar ist, könnte die Auffassung vertreten werden, Bewerberinnen und Bewerber hätten selbst schuld, wenn sie keinen Arbeitsplatz erhielten, weil sie sich mehr oder weniger im Internet oder in sozialen Netzen wie auch immer präsentierten.
Hierbei ist es jedoch sehr fraglich, ob Daten in sozialen Netzen überhaupt allgemein zugänglich sind. Vielfach glauben die Nutzerinnen und Nutzer sozialer Netze, sicher und ungestört unter sich sein zu können, nicht zuletzt aufgrund mehr oder weniger seriöser Hinweise der Telediensteanbieter, die Vertraulichkeit der sozialen Netzwerke zu garantieren.
Aber auch wenn diese Netze nicht sicher vor unbefugtem Zugriff sind, insbesondere weil jedermann auch mit einer falschen Identität ohne besonders großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft Zugang zu sozialen Netzen erhält, kann nicht automatisch vom Vorhandensein allgemein zugänglicher Daten ausgegangen werden.
Unabhängig davon hätten Datenschutzbestimmungen nicht zuletzt die Aufgabe, verwendungsbedingte Verfälschungen personenbezogener Daten zu verhindern. Die Gefahr einer Verfälschung sei dort besonders hoch, wo einzelne Angaben, wie bei der automatisierten Verarbeitung, aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgelöst und in immer neue Verwendungszusammenhänge eingefügt würden. Nichts anderes gelte für die Verwendung allgemein zugänglicher Daten. Sobald sie ihrer jeweiligen Quelle entnommen würden, verwandelten sie sich in eine eigenständige Informationsquelle, die zwangsläufig einem Verständnis und einer Deutung zugänglich wäre, die nicht mehr vom ursprünglichen Informationszusammenhang bestimmt werde.5
5Simitis, Randnummer 186 zu 28 Absatz 1 Nummer 3 Bundesdatenschutzgesetz
Die Folgen könnten für die Betroffenen gravierender sein als die Verwendung mancher sensibler und prinzipiell unzugänglicher Daten. Es genüge, an die Verknüpfung von Angaben zu denken, die in alles andere als vergleichbaren Zeitungen oder Zeitschriften zu sehr verschiedenen Zeiten sowie aus sehr unterschiedlichen Anlässen publiziert worden sind. Daraus könne sich leicht eine verzerrte, für die Betroffenen gefährliche Darstellung ihrer Person ergeben. Selbst wenn gegen die Einzelinformationen nicht das Geringste einzuwenden sei, bräuchte das durch die Verarbeitung entstandene Informationsmosaik noch lange nicht akzeptabel sein.6
6Simitis, Randnummer 186 zu 28 Absatz 1 Nummer 3 Bundesdatenschutzgesetz
Insoweit kann Bewerberinnen und Bewerbern nicht vorgehalten werden, sie seien selbst schuld, wenn sie wegen ihrer Teilnahme am Web 2.0 keinen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Ihre schutzwürdigen Interessen an einer ungestörten Privatsphäre treten gegenüber dem Informationsbedürfnis von Arbeitgebern nicht zurück und sind zu beachten.
8. Abschließende Bewertung
Unabhängig davon, dass die Internet-Recherche durch Arbeitgeber aus den unter Nummer 3 genannten Gründen nicht erforderlich ist, überwiegen aus den unter Nummer 4 bis Nummer 6 genannten Gründen schutzwürdige Interessen der Bewerberinnen und Bewerber an dem Ausschluss dieser Datenverarbeitung. Auch der Vorsitzende Richter am Bundesarbeitsgericht, Franz-Josef Düwell, zieht in Zweifel, ob diese Datennutzung für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist.7
7DSB 11/2009, Seite 22 (Zeitschrift Fachanwalt Arbeitsrecht, FA 9/09, Seite 268)
Die Recherche in sozialen Netzwerken und Internet-Suchmaschinen ohne ausdrückliche und wirksame Einwilligung ist daher nicht zulässig und kann nach 43 Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 3 Bundesdatenschutzgesetz mit einer Geldbuße von bis zu 300.000 Euro geahndet werden.
- an0N_1223859399z
Zum Bedienen
welcher Programme meinst Du denn konkret??? - an0N_1223859399z
Wenn du...
das so interpretierst. die gedanken sind frei ;-) - In Telefon...
.. träum weiter
*lach-mich-scheckig - an0N_1223859399z
Naiv?
ok. ich gebs zu.
die NWO-leute kontrollieren alles
big brother ist realität
und die personaler dieser welt haben eine synthetische erweiterung der frontalen hinlappen, um sich alle bewerbungsfotos und auch alle zugehörigen einträge in gewissen foren merken zu können Bilderkennung...
im bewerbungsverfahren gibts nur bei den firmen mit 3 buchstaben.
alle anderen personaler sind froh, wenn sie google richtig bedienen können. ausserdem gilt das nur für die kandidaten in der endrunde, denn kein mensch hat zeit, bei 250 bewerbungen einen background-check durchzuführen.
Schon möglich....
aber nicht von der neuen praktikantinSchutz vor schwangerschaft...
sehr wahrscheinlich,
vor allem anderen... das musst du selbst entscheiden. im zweifel immer HIV-test und hepatitis-test zeigen lassen- judy_12137610
Das erste mal....
wird oft überbewertet.
und wenn er nicht weiss, wie er sich anstellen soll, lass ihn mal 2GTS googeln ;-) viel spass
Üb schon mal...
mit nem dildo / vibrator. und immer schön mit gleitcreme.
wenn das gut funktioniert, bist du bei deinem freund auch nicht mehr so nervös oder verkrampft. denn du weiss ja, dass es einwandfrei funzt ;-)Also wenn ich ne frau wäre....
würde ich im falle meiner verurteilung sage, dass ich mir nen ONS in einer bar geangelt habe und besseres zu tun hatte, als mir seinen ausweis zeigen zu lassen ;-)Sex ist....
ein elementarer bestandteil einer partnerschaft.
kein befriedigender sex = keine gute partnerschaft
ganz ehrlich, such dir nen kerl, der dich um den verstand bringt. am besten viele viel jahre!
Die Frage sollte vielmehr sein....
... änder die Information etwas an deiner Situation?
Man sollte nicht fragen, wenn man die Antwort eigentlich nicht wissen will.
- In Nacktpics
Fake-alarm
wenn ich für jeden kerl, der mit geklauten bildern und einer weiblich klingenden email-addi versucht die leute für dumm zu verkaufen, einen euro bekommen würde, bräuchte ich nicht mehr zu arbeiten ;-) Beherrschung....
ist reine kopfsache! das ist nicht krank, sondern nur unerfahren.
abhärten.. *lachmichschlapp
vielleicht mit dem hammer draufhauen?So wiedersinnig es klingt....
vielleicht kannst du ihm ganz vorsichtig beibringen, nicht so viel zu ...
hintergrund ist folgender: i.d.r. versuchen viele männer beim onanieren möglichst schnell zu kommen. auf diese weise konditioniert passiert das gleiche bei der frau.
und wenn er sich beim vorspiel mehr auf dich konzentriert, als auf sich, sollte sich die "standzeit" nach und nach verlängern.
yoga, autogenes training und meditative übungen sind in dem zusammenhang extrem hilfreich. es geht dabei um kontrolle über den eignen körper.
Kein druck!
je mehr du dich selbst unter druck setzt, desto geringer ist die chance, dass es dir spass macht.
ok. kein geschwafel, praktischer tip: besorg dir ne gute gleitcreme und nimm reichlich davon. dann ist es wenigstens nicht unangenehm.